Sie galt als Meilenstein deutscher Ingenieurskunst, doch heute fällt sie auf einer Geisterstrecke dem Rost anheim – die Magnetschwebebahn »Transrapid«. Während man durch Deutschland in verspäteten Zügen rollt, schwebt man in China längst mit 500 km/h im Hochgeschwindigkeitszug – mithilfe deutscher Hochtechnologie. Vom Emsland nach Shanghai: Bilanz eines Wissenstransfers.
»Mehr Platz am Himmel und auf den Straßen« lautete das Versprechen in einem Transrapid-Werbefilm von 1997. Autofahrer und Kurzstreckenflieger sollten vom Umstieg in die schnelle Magnetschwebebahn überzeugt werden, hinein in bequemere Sitze, mit viel Platz auch auf den Gängen. Doch nicht nur komfortabel, sondern auch wirtschaftlicher, zeitsparend und umweltfreundlich sollte der Transrapid sein – all das aber nicht auf, sondern wenige Zentimeter über den Schienen: »Fliegen auf Höhe Null«, so ein Slogan. Das klang damals nach einer zukunftsträchtigen Technologie.
Doch begonnen hatte die Geschichte des Transrapid bereits viel früher, nämlich im Jahr 1934. Der ›Vater‹ dieses neuartigen Verkehrsmittels, der Diplom-Ingenieur Hermann Kemper, meldete damals eine »Schwebebahn mit räderlosen Fahrzeugen, die an eisernen Fahrschienen mittels magnetischer Felder schwebend entlang geführt wird« als Patent an. Schon als Student an der Technischen Hochschule Hannover ging Kemper bei seinen Berechnungen von Fahrgeschwindigkeiten bis zu 500 km/h aus. Doch es sollten noch drei Jahrzehnte vergehen, bis er Förderer fand und man einen funktionsfähigen Prototypen – zunächst als Miniaturmodell – präsentieren konnte.
1969 stellte das – heute in chinesischem Besitz befindliche – Maschinenbauunternehmen »Krauss-Maffei« den »Transrapid 01« vor, damals noch misstrauisch begutachtet von Kollegen, die bezweifelten, dass er wirklich schwebte und nicht etwa versteckte Räder verbaut wurden. Tatsächlich ist die Funktionsweise dieses ›technischen Wunders‹ bis heute nahezu gleich geblieben: Zwei Magnetgruppen lassen den Zug praktisch berührungsfrei auf seiner Spur schweben – die in der Fahrbahn verbauten »Tragmagnete« ziehen von unten das Fahrzeug an, in dem wiederum »Führmagnete« stecken, die es in der Spur halten. Durch eine die Fahrbahn quasi umklammernde Form des Fahrzeugs ist es praktisch unmöglich, dass es entgleist.
Wenn Innovation auf Zögerlichkeit trifft, bleibt sie auf der Teststrecke
Ein »Wunderwerk« – made in Germany
Konkret geplant wurde der Hochgeschwindigkeitszug in den 1970er-Jahren, ab 1983 entstand eine Teststrecke, auf der immer höhere Geschwindigkeiten erreicht wurden – 1993 dann mit 450 km/h der in Deutschland bis heute unübertroffene Rekord. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab die Bundesregierung endlich die Bauplanung einer knapp 300 Kilometer langen Trasse zwischen Berlin und Hamburg bekannt. In unter einer Stunde Fahrzeit sollten die beiden Millionenstädte erreicht werden, eine technische Meisterleistung, von der man heutzutage– während der aktuell doppelt so langen Fahrt – nur noch träumen kann.
Eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Pioniergeist Hermann Kempers die Grundlage schaffte für eine Hochleistungsschnellbahn, die bald von industriellen Schwergewichten wie Siemens und ThyssenKrupp weiterentwickelt wurde: Neben der Strecke Berlin-Hamburg wurden ein Flughafenzubringer in München und ein Metrorapid in Nordrhein-Westfalen geplant, auch in den USA war man interessiert an dem technischen »Wunderwerk« made in Germany. Mit dem Transrapid 08 wurde das erste Modell in Serie gebaut und es ist bis heute das einzige Verkehrsmittel, das bei allen Geschwindigkeiten vollautomatisiert fahren darf – nur eben in Deutschland nicht.
Denn auch wenn es die »Thyssenkrupp Transrapid GmbH« noch heute gibt: Zum Einsatz außerhalb der Teststrecken kam das fortschrittliche Fahrzeug im Land seines Erfinders nie. Aber was waren die Gründe dafür, dass eine solche technische Innovation im Land der Konstrukteure wieder verschwand, warum endete ein jahrzehntelanges Projekt mit einzigartigen Potenzial auf stillgelegten Teststrecken und in Technikmuseen? Ein vermeintlicher Fall von »German Angst«, der angeblich so ›typisch deutschen‹ Zögerlichkeit?
Der Exportschlager gerät in Gefahr
Der heute gesellschaftlich akzeptierte Umweltschutz hätte mit dem Transrapid jedenfalls schon damals beste Voraussetzungen gehabt: Im Gegensatz zum ebenerdigen Rad-Schiene-System fährt der Transrapid auf Stützpfeilertrassen wie eine Hochbahn über Wiesen, Berge und Straßen hinweg – ohne diese zu »durchbrechen«. Wildwechsel, Landwirtschaft und Verkehr werden darunter weitaus weniger beeinträchtigt als bei herkömmlichen Verkehrssytemen. Doch ausgerechnet Tierschützer und Umweltaktivisten stellten sich gegen die Technologie – die Grünen bezeichneten sich gar als »Bremser eines Unsinnsprojektes«.
Mit der immer länger werdenden Entwicklungszeit kam bald auch Kritik aus den Reihen der eigentlichen Befürworter, denn der Kostenplan explodierte: Aus den ursprünglich kalkulierten 7 Milliarden waren um die Jahrtausendwende satte 11 Milliarden geworden. Ein Streit zwischen Finanzexperten, Politikern und Industrie entbrannte, bis sich schließlich sogar ein Partner des Firmenkonsortiums, das den Transrapid entwickelte, ausstieg. Auch in der Bevölkerung stieß der öffentlich ausgetragene Streit um den Transrapid auf Kritik. Der Transrapid sollte ein neuer deutscher »Exportschlager« werden, doch nun schienen Planungszeit und Forschungsgelder sinnlos vergeudet, der Transrapid als Prestigeprojekt der deutschen Wirtschaft ›verbrannt‹. Doch ein sich gerade zur wirtschaftlichen Supermacht aufschwingendes Land beobachtete die Entwicklung in Deutschland sehr genau.
Shanghai Transrapid: In Asien schwebt man mit deutscher Technik – in Deutschland bleibt man am Boden.

2002, als der Transrapid in Deutschland bereits auf der Kippe stand, flog eine deutsche Regierungsmaschine nach China – neben dem Kanzler und Mitgliedern des Verkehrsministeriums waren vor allem Vertreter der Industrie mit an Bord. In Shanghai angekommen, sollten sie in Augenschein nehmen, was sie nur zwei Jahre zuvor erfolgreich an das Reich der Mitte lizensiert hatten: Deutsche Ingenieurskunst, in Jahrzehnten entwickelt, mit Hunderten Millionen Steuergeldern gefördert – und im eigenen Land gescheitert?
Nun profitierte das kommunistische China von Kempers Erfindung und den hohen Entwicklungskosten, die bereits in Deutschland in das Verkehrsprojekt gesteckt wurden. Und nun ging auf einmal alles sehr schnell: die deutsche Industrie lieferte das Know-How und die serienreifen Bauteile – und der chinesische Staatskonzern stellte die erste Strecke in kürzester Zeit fertig. In Asien schien möglich, was im »alten Europa« scheiterte. Während in China die Magnetschwebebahn schon längst im Einsatz war, erschütterte in Deutschland ein Verkehrsunglück die Öffentlichkeit, welches das Ende der Transrapid-Euphorie einläutete.
Noch hat Asien die Nase vorn
Das Emsland im Nordwesten Deutschlands: Hier wurde bereits in den 1980er Jahren eine 30 Kilometer lange Teststrecke gebaut, seitdem waren hundertausende Besucher mit der Magnetschwebebahn probegefahren und hier erreichte der Zug auch erstmals seine Rekordgeschwindigkeit von 450 km/h. Eine technische Attraktion für die ländliche Region, die begeistert aufgenommen wurde.
Doch 2006 war es damit schlagartig vorbei: ein Transrapid 08 raste in ein auf der Fahrbahn vergessenes Wartungsfahrzeug – und riss bei dem Aufprall 23 Menschen in den Tod. Ein tragisches Unglück, das letzlich auf »menschliches Versagen« zurückgeführt wurde. Der Betrieb wurde einige Jahre später eingestellt und die gesamte Anlage soll bis 2034 rückgebaut werden – für insgesamt 68 Millionen Euro. In die Entwicklung dieser Technologie flossen Jahrzehnte und Millionen, für deren ›Abwicklung‹ hat sich dies wiederholt. Und in Asien? Wie geht es dort mit den schwebenden Zügen weiter?
Seit dem Wissenstransfer vom Westen in den Osten entwickelte man dort Kempers Technologie immer weiter – und stellt immer wieder neue Geschwindigkeitsrekorde auf: Japan stellte schon 2015 eine eigene Magnetschwebbahn vor, die im Testbetrieb 600 km/h erreichte und im Regelbetrieb mit 500 km/h fahren soll. Das aktuelle chinesische Modell kündigt bereits im Namen sein Tempo an – geht es nach den Plänen des Staatskonzerns CRRC, soll der »CF600« seinem deutschen Vorbild auch im Regelbetrieb mit 600 km/h davonrasen. Doch auch das ist den Chinesen noch nicht schnell genug: Das volle Potenzial dieser Züge soll erst bei Tempo 800 km/h ausgeschöpft sein. Damit bewegt man sich bereits in den Leistungsbereich von Linienflugzeugen! In Deutschland muss man sich derweil mit maximal 300 km/h zufriedengeben und auch das nur, wenn der »ICE-Sprinter« diese auf bestimmten Streckenabschnitten fahren kann.
War der Transrapid in Deutschland nicht gewollt?
Häufig lautet die Antwort auf die Frage, warum sich Innovationen letzlich nicht durchsetzen: »Die Kosten sind zu hoch.« – sie wird auch bei der Diskussion über das Scheitern des deutschen Transrapids eingebracht. Fehlkalkulationen und Finanzkrisen waren wohl auch hier ein Grund, warum die Magnetschwebetechnologie trotz oder gerade wegen der bereits hohen Entwicklungskosten in Deutschland wieder ›in der Schublade verschwand‹. Doch auch in China und Japan liegen die Investitionskosten inzwischen im hohen zweistelligen Millardenbereich – und zumindest bei den Japanern regen sich in letzter Zeit auch Bedenken wegen der Auswirkungen auf die Umwelt. Dort sollen die Züge sogar in Tunneln durch das Land führen.
In Deutschland wird aber von Soziologen noch ein ganz anderer Grund angeführt, warum er dort nicht umgesetzt wurde: Nicht die Technologie selbst sei gescheitert, sondern der gesellschaftliche Prozess, der für die breite Akzeptanz einer Innovation notwendig sei. So sagt beispielsweise der Organisationswissenschaftler Marcel Schütz, dass der Transrapid zwar technisch gesehen seiner Zeit weit voraus war, er sich aber in bestehende »sozio-technische Konstellationen« hätte einfügen müssen. Zu diesen zählt Schütz bereits vorhandene Infrastrukturen, wirtschaftliche und politische Interessen, aber auch die Zukunftsvorstellungen einer Gesellschaft. Im Fall der vermeintlich überlegenen Magnetschwebebahn traf diese auf das seit 200 Jahren bestehende Rad-Schiene-Netz, in das sich der Transrapid mit seinem neuartigen Spursystem nicht so leicht hätte integrieren können.
Man nimmt der Schwebebahn die Luft – und haucht ihr damit neues Leben ein
Die Wiedergeburt der Magnetschwebebahn
Die scheinbare »Alternativlosigkeit« zur etablierten Bahninfrastruktur bezeichnet Schütz als »Lock-In-Effekt«, der Transrapid wirkte dagegen wie eine »Insellösung«. Denn als die Entwicklung des Transrapids Ende der 1980er-Jahre erst langsam »in Fahrt« kam, wurde mit dem InterCityExperimental (ICE-V) ein System getestet, das die Lücke zum Flugverkehr ebenfalls schließen sollte – und das auf dem bestehenden Schienennetz. Der – aufgemerkt – Vorläufer heutiger ICE-Züge, knackte damals im Testbetrieb bereits die 400 km/h-Marke. Und der französische V150 war schon 2007 mit 574,8 km/h Spitzengeschwindigkeit der bis heute schnellste Rad-Schiene-Zug Europas. Nur, warum fahren die aktuellen Modelle dann nicht mit solchen Höchstgeschwindigkeiten quer durch unseren Kontinent?
Genau hier kommen sie eben doch wieder zum Vorschein, die Nachteile des konventionellen Zugverkehrs: Während ein Transrapid praktisch verschleißfrei über seiner Spur schwebt, nimmt beim ›guten alten‹ Rad-Schiene-System mit steigendem Tempo auch der Luft- und Rollenwiderstand stark zu, was enorme Energie- und Wartungskosten mit sich bringt.
Auch der Europäische Rechnungshof sieht einen entscheidenden ›Bremsklotz‹ auf dem bestehenden Schienensystem liegen und kritisiert dieses aktuell als »unwirksamen Fleckenteppich«. Die Kosten der für hohe Geschwindigkeiten ausgelegten Strecken seien mit bis zu 369 Millionen Euro pro eingesparter Minute zu beziffern – gleichzeitig lägen die Durchschnittgeschwindigkeiten aber nur bei 45 % der Höchstkapazität. Damit kommt ein weiteres Hindernis für Highspeed auf Schienen hinzu: Anders als die auf separaten Hochtrassen fahrende Magnetschwebebahn, rollen die konventionellen Züge quer durch landwirtschaftliche und urbane Strukturen – und schweben eben nicht darüber.

Und sie schwebt doch – mit entspannten 150 km/h.
Ganz vergessen ist das technische Wunderwerk Kempers in Deutschland aber dennoch nicht: Ein bayerisches Unternehmen entwickelte mit dem zukunftsträchtigen »TSB« ein ebenfalls auf der Magnetschwebetechnologie basierendes Verkehrskonzept. Das Transport System Bögl ist allerdings von vornherein für den Nahverkehr gedacht und fährt mit entspannten 150 km/h, bisher nur auf einer Teststrecke. Dafür liefert Bögl das gesamte System aus einer Hand – vom Bau der Betontrasse bis zum fertigen komfortablen Fahrzeug. Erleben wir also bald eine schwebende Stadtbahn? Die Stadt Nürnberg hat jedenfalls schon Interesse bekundet und dieses mit einer Machbarkeitsstudie unterstrichen.
Derweil erscheint am Zukunftshimmel bereits ein weiterer Hoffnungsträger für den Hochgeschwindigkeitsverkehr – auch er kommt aus dem schönen Bayern: An der Technischen Universität München entwickelte man Kempers Ideen weiter, indem man der Magnetschwebebahn quasi ›die Luft nahm‹. Mit der Hyperlooptechnologie↗ sollen bald durch Vakuumröhren schwebende Passagierkapseln Europas Städte miteinander verbinden. Höchstgeschwingigkeit: 900 km/h. Wird diese Technologie den gesellschaftlichen Zuspruch gewinnen, der dem Transrapid am Ende fehlte? Die Entwickler an der TUM sind jedenfalls überzeugt: »Wenn die Menschen es wollen, dann kommt es. Technisch können wir es«.
ARTIKEL TEILEN
LESEN SIE AUCH
Migration in eine neue Heimat: Die erste Marssiedlung
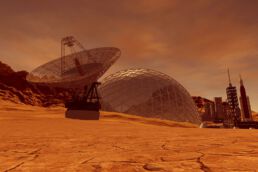
Traumkultur: Mythos, Kunst und Forschung

Faustisches Feuer oder kalte Asche?

Europas Mission im Weltall








